Herforder Chronik (1910)/277
| GenWiki - Digitale Bibliothek | |
|---|---|
| Herforder Chronik (1910) | |
| <<<Vorherige Seite [276] |
Nächste Seite>>> [278] |
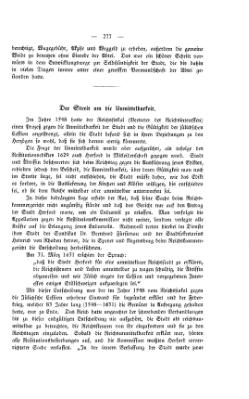 | |
| Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien | |
| Texterfassung: korrigiert | |
| Dieser Text wurde anhand der angegebenen Quelle einmal korrekturgelesen. Bevor dieser Text als fertig markiert werden kann, ist jedoch noch ein weiterer Korrekturdurchgang nötig.
| |
berechtigt, Wagegebühr, Akzise und Weggeld zu erheben, außerdem die gemeine Weide zu benutzen ohne Einrede der Abtei. Das war ein schöner Schritt vorwärts in dem Entwicklungswege zur Selbständigkeit der Stadt, die bis dahin in vielen Dingen immer unter einer gewissen Vormundschaft der Abtei gestanden hatte.
Der Streit um die Unmittelbarkeit.
Im Jahre 1548 hatte der Reichsfiskal (Vertreter der Reichsinteressen) einen Prozeß gegen die Unmittelbarkeit der Stadt und die Gültigkeit der jülichschen Cession angestrengt, allein die Stadt befand sich in ihren Beziehungen zu den Herzögen so wohl, daß sie sich darum wenig kümmerte.
Die Frage der Unmittelbarkeit wurde aber aufgerührt, als infolge des Restitutionsediktes 1629 auch Herford in Mitleidenschaft gezogen ward. Stadt und Äbtissin beschwerten sich beim Reichstag gegen die Ausführung jenes Ediktes, erhielten jedoch den Bescheid, die Unmittelbarkeit, über deren Gültigkeit man noch im Streite liege, sei nicht entschieden, die Stadt müsse daher, wie das Edikt es fordere, in die Auslieferung der Kirchen und Klöster willigen, bis entschieden sei, ob sie dem Reiche mittelbar oder unmittelbar unterworfen sei.
In dieser bedrängten Lage erfuhr der Rat, daß seine Sache beim Reichskammergericht nicht ungünstig stände und daß das Gericht nur auf den Antrag der Stadt Herford warte, um ein Endurteil zu erlassen. Man verfolgte die Appellation gegen die Restitutionskommissare nicht weiter, sondern verlegte alle Kräfte auf die Erlangung jenes Endurteils. Ruhmvoll treten hierbei im Dienste ihrer Stadt der Syndikus Dr. Bernhard Fürstenau und der Stadtsekretarius Heinrich von Rhaden hervor, die in Speyer und Regensburg beim Reichskammergericht die Entscheidung herbeiführten.
Am 31. März 1631 erschien der Spruch:
„daß die Stadt Herford für eine unmittelbare Reichsstadt zu erklären, die Reichssteuern und Lasten unmittelbar zu tragen schuldig, die Äbtissin abzuweisen und wie Jülich wegen der Cession und vorgegebenen Interesses ewiges Stillschweigen aufzuerlegen sei.“
Mit dieser Entscheidung war der im Jahre 1548 vom Reichsfiskal gegen die Jülichsche Cession erhobene Einwand für begründet erklärt und der Federkrieg, welcher 83 Jahre lang (1548-1631) die Gemüter in Aufregung gehalten hatte, war zu Ende. Das Reich hatte ungeachtet der schwebenden Verhandlungen bis zu dieser endgültigen Entscheidung nie aufgehört, die Stadt als reichsunmittelbar zu betrachten, die Reichssteuern von ihr einzufordern und sie zu den Reichstagen einzuladen. Sobald die Reichsunmittelbarkeit erklärt war, hörten alle Restilutionsbestrebungen auf, und die Kommissare mußten Herford unverrichteter Sache verlassen. „In der innern Verfassung der Stadt wurde zwar