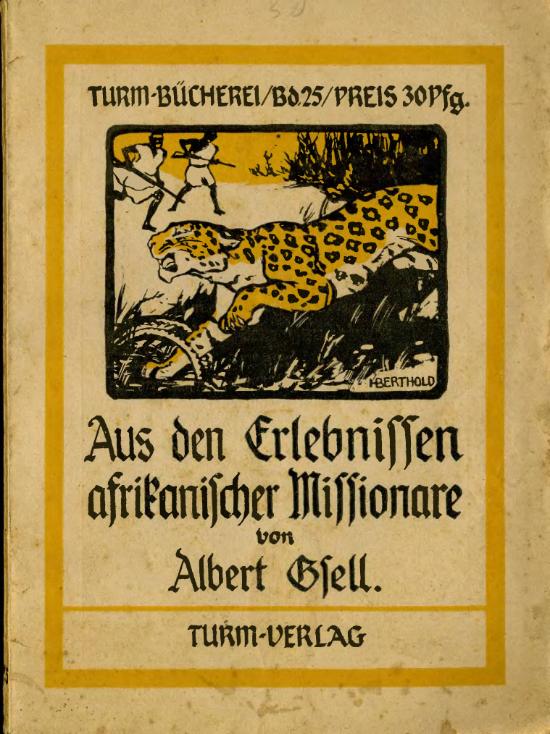Aus den Erlebnissen afrikanischer Missionare/E-Book
| GenWiki - Digitale Bibliothek | |
|---|---|
| Aus den Erlebnissen afrikanischer Missionare | |
| Autor(en): | Albert Gsell |
| Titel: | Aus den Erlebnissen afrikanischer Missionare |
| Verlag: | Turm Verlag |
| Druck: | C. Grumbach in Leipzig, Fürstl. Wald. Hoflieferant. |
| Ort: | Leipzig |
| Jahr: | [1914] |
| Umfang: | 56 Seiten |
| GenWiki E-Book | |
| Editionshinweise zum E-Book: Das Digitalisat (DjVu) dieses E-Books können Sie hier herunterladen. Zur Druckversion des Textes gelangen Sie in der linken Navigation unter „Werkzeuge“. → Benutzerhinweise zu E-Books | |
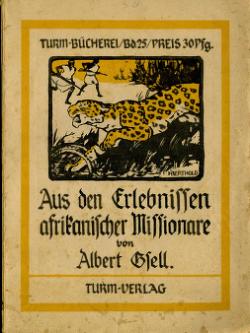
| |
| fertig | |
| Dieser Text wurde zweimal anhand der angegebenen Quelle korrekturgelesen.
| |
(Titel ≡)
Aus den Erlebnissen afrikanischer Missionare
Von
Missionar Albert Gsell Vertreter der Basler Missionsgesellschaft in Frankfurt a. M.
Mit Bilderschmuck
<VERLAGSSIGNET>
Turm-Bücherei. Herausgegeben von
Alle Rechte vorbehalten.
Druck von C. Grumbach in Leipzig (Inhalt ≡)
Inhalt.
Familie Gsell mit ihren schwarzen Hauskindern.
I. Einleitung. Wenn ich jetzt daran gehe, einiges aus den eigenen und den Erlebnissen anderer, befreundeter Missionare zu schildern, so muß ich dem lieben Leser eigentlich zuerst meine Visitenkarte abgeben; vielleicht weiß er am Ende gar nicht recht, was eigentlich ein Missionar –
Die Bekanntlich trat Deutschland im Jahre 1884 in die Reihe der Kolonialmächte ein; sein überseeischer Besitz umfaßt jetzt mit dem an Gütern und Gewinn vorerst noch zweifelhaften Neukamerun etwa 2 800 000 Quadratkilometer mit zirka 16 Millionen Einwohnern und steht der Ausdehnung nach unter den Kolonialreichen der Weltmächte an dritter Stelle. Vor der Erwerbung waren nur zwei Gebiete, Togo und Südwestafrika, Arbeitsfelder deutscher Missionare, und gerade dadurch war ihre Besitzergreifung veranlaßt worden; über „Südwest“ schrieb damals Major v. François: „Ohne die Pionierarbeit der Missionare wäre die Besitzergreifung des Landes ein Pionier- (6 ≡) weiterarbeiten. Die Mission ist ein unpolitisches Werk und steht über den nationalen Grenzen. Damit ist aber nicht gesagt, daß unsere Missionsgesellschaften nicht sofort die besondere Aufgabe und Bedeutung ihrer Arbeit für die deutschen Kolonien erkannt hätten. Sie steigerten ihre Kraft und nahmen alle noch unbesetzten deutschen Kolonien in Angriff. Seit Beginn unserer Kolonialgeschichte stieg die Zahl der deutschen missionarischen Arbeitskräfte von 526 auf 1350, die der Beiträge von 23/4 auf über 8 Millionen Mark, und von diesem Wachstum ist der beträchtlichste Teil unseren Kolonien zugute gekommen.
Daß die Arbeit der Missionen von eminenter Bedeutung für unsere Kolonien ist, wird nachgerade allgemein anerkannt; so sprachen sich z. B. auf dem 3. und 4. Kolonialkongreß mehrere Kongreßmitglieder, wie der Vorsitzende der Hamburger Handelskammer, Schinckel, und der bekannte Forschungsreisende Dr. Neuhaus, ebenso Exzellenz Dernburg, höchst anerkennend über die Wirksamkeit der Missionen aus. Die Bedeutung der Mission für unsere Kolonien liegt auf wirtschaftlichem, geistigem und sozialem Gebiet. Wirt- (7 ≡) Basler Missionshandlung ein in Westafrika bis dahin unbekannter Handelsartikel auf den Weltmarkt gebracht wurde, die Palmkerne, heute ein wichtiger Exportartikel. Und welcher Segen entsprießt der Kolonie aus der stillen Arbeit der deutschen Missionsfrau, die die Eingeborenen zur Reinlichkeit und zum Ordnungssinn erzieht und ihnen ein Vorbild edler deutscher Häuslichkeit gibt!
Fassen wir das Gesagte zusammen, so ergibt sich, daß wir Missionare durch unser Vorbild die Arbeit, die namentlich in Afrika durch die jahrhundertelange Sklaverei mit dem Brandmal der Schande gestempelt ist, zu Ehren bringen und damit einen Kulturfaktor in Bewegung setzen, der für die gedeihliche Entwicklung eines jeden Volkes von großer Bedeutung ist. Erweckung Sprach- (8 ≡) Leistungen eine Kulturarbeit ersten Ranges dar.
Schul- Nicht minder als die wirtschaftliche und geistige Arbeit (9 ≡) Soziale Arbeit. fällt die Fürsorge der Mission für die soziale Hebung der Eingeborenen ins Gewicht; wir erwähnen besonders die Kämpfe gegen die Sklaverei, die Erniedrigung der Frau in der Polygamie (Vielweiberei) und den Branntweinhandel. Der Charakter eines Volkes hängt wesentlich ab von dem ganzen Stand seiner materiellen und geistigen, insbesondere auch sittlichen Kultur; eine durch Sklaverei, Vielweiberei, Branntwein und liederlichen Lebenswandel degenerierte und demoralisierte, entnervte, abgestumpfte,[GWR 1] arbeitsscheue und verarmte Bevölkerung ist auch weder konsumtions- noch produktionsfähig! Hier hat nun besonders die Arbeit der ärztlichen Mission ein weites, ersprießliches Feld der Tätigkeit. Wer aus eigener Erfahrung die krasse Unkenntnis in der Behandlung der Krankheiten mit angesehen hat, wer die unter den Schwarzen weitverbreiteten Krankheiten, Syphilis, Dysentrie, Malaria, Aussatz, Schlaf-, Wurm- und Leberkrankheiten, und das durch sie erzeugte Elend miterlebt hat, der lernt die Bedeutung der ärztlichen Mission erst voll würdigen, – so würdigen, daß er selbst auch mithilft oder diesen Werken opferwillige Unterstützung leiht. Es bleibt doch dabei: die Nächstenliebe gehört zu den größten idealen Gütern des Christen; wehe unserm deutschen Volke, wenn es dieses ideale Gut gering achtet und Egoismus und Materialismus an seine Stelle setzt! Damm (10 ≡)
Auch ich empfehle dem lieben Leser das Studium der Mission und lade ihn nun ein, mit mir nach Afrika zu kommen, wo ich selbst beinahe 10 Jahre im Dienst der Basler Mission unter den Aschanti- und Akemnegern der Goldküste in Westafrika zugebracht habe. Da gibt's manches zu erzählen, vom Urwald und der Savanne, von Tropenhitze und Regenzeit, von Abenteuern mit Schlangen, Leoparden, Wanderameisen, von Zauberern, Fetischpriestern und Götzenfesten, und ich glaube, nach all dem ist der freundliche Leser dann dankbar, daß er nicht in Afrika wohnen muß, sondern bei uns in unserm lieben deutschen oft mit Unrecht geschmähten Vaterlande leben und arbeiten darf.
II. Afrikanische Wanderungen.a) Fieberkrank und dem Verdursten nahe!Das
Und doch gilt es auch für den deutschen Kulturpionier:
Ich war etwa ein halbes Jahr erst draußen, da hatte ich schon die ersten schweren Fieber zu bestehen; – nicht (11 ≡) im schön eingerichteten Krankenhaus, nein, auf der Reise im Urwald, in der Harmattanzeit, der trockensten, heißen Jahreszeit kam es wie ein Sturm über mich:
Die Aber auch dem Europäer spielt der Wind übel mit; viele Weiße laufen mit blutigen, aufgesprungenen Lippen umher; an den Händen zeigen sich rissige Stellen. Im Hause kracht das Gebälk und das Wellblech des Daches ächzt in den Fugen. Auf dem Schreibpult krümmen sich die Deckel der Bücher und manche gehen aus dem Leim. Fast jedermann hat Schnupfen und Katarrh und unter den Negern herrscht Lungenentzündung. Der Wasservorrat (12 ≡)
Wasser- Im Hinter ihm drein keuchen seine schwarzen Begleiter, die ihn tragen – denn Pferde, Kühe, Ochsen, Esel gibt's nicht, da die Tsetsefliege alles größere Vieh tötet – es sind im ganzen drei Hängemattenträger und ein Kistenträger. Drei Stunden weit haben sie bereits ihren „Meister“ getragen, zwei Stunden ist er marschiert. „Du,“ sagt der stämmige Ata zu seinem Gefährten, dem hageren, baumlangen Abokyi, „du, heute kommt unser Meister gar nicht vorwärts; er ist wohl müde oder krank.“ Und wirklich, der junge „Meister“ fühlt sich ungewöhnlich müde und matt. (13 ≡)
Der König Akufo von Akuapem, in dessen Hauptstadt Akropong wir
(14 ≡)
Die Füße wollen ihren Dienst versagen; und erst der entsetzliche Durst! Schon mehrmals hat er gefragt, ob's denn keinen Fluß oder Bach in der Nähe gebe, oder ob man denn nicht bald an eine Plantage oder an ein Dorf komme. Aber umsonst. Das nächste Dorf liegt noch zwei Studen vor ihm; die Bäche sind versiegt. Und woher nur diese Müdigkeit und das bohrende Kopfweh? Sonst ist er doch auch schon viel und oft marschiert – noch vor 2 Jahren beim Militär mit den 122 ern in Heilbronn a. N. ist er oft genug auf dem Exerzierplatz herumgesprungen! – heute kann er kaum den Felsen hinauf, über den der Weg führt; an beiden Armen müssen ihn die Träger hinaufziehen. Oben ruhen sie aus, dann geht's weiter. Ein Hochzeitszug kommt ihnen entgegen; ein junger Lehrer der Mission ist es, mit seiner Frau und einigen Freunden, die weiter landeinwärts ziehen, nach Abetisi, wohin der Lehrer versetzt ist. „Habt ihr kein Wasser oder eine erfrischende Frucht?“ „Nein, tut uns leid, daß wir nicht helfen können.“ – Also weiter. Endlich versagt die Kraft, und der junge Missionar kann nicht mehr weiter. „Geht,“ ruft er seinen Begleitern zu, „holt mir Wasser, und wenn ihr's eine Stunde weit herbeibringen müßt!“ Man sieht, er ist ein Neuling, denn sonst hätte er sich für seine Reise in der trockenen Jahreszeit mit etwas Trinkbarem versehen. Nun macht er die erste schlimme Erfahrung und er glaubt, sein letztes Stündlein sei gekommen. Doch gemach, so weit ist es noch nicht. Gott gibt dem Müden neue Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Die kurze Rast tut ihm gut; er erholt sich wieder, und da bringen auch seine Leute das ersehnte Wasser. Wie wohl tut der Labetrank! Nach einer Stunde wird die Reise fortgesetzt. Sorgsam betten die besorgten Schwarzen ihren Meister in die Hängematte, und nun tragen sie ihn dem Ziel entgegen. Endlich, am Abend, ist der Filialort Obom und am nächsten Morgen die Station Akropong erreicht. Hier bricht nun auch das Malariafieber, dessen Vorboten (15 ≡) sich den Tag zuvor durch Mattigkeit der Glieder gemeldet hatten, mit aller Heftigkeit aus – das erste Fieber in Afrika. Sechs Tage hält es an, endlich ist es gebrochen, und vierzehn Tage später geht's wieder hinein in den Urwald von Akem zu neuer Arbeit und neuem Wirken – dankbaren Herzens angesichts der erfahrenen Durchhilfe.
Längst liegen jene Tage hinter mir, und das Bild davon will allmählich erblassen; aber noch gerne gedenke ich ihrer und wünschte, sie wären noch vorhanden. Manch treuer Gefährte und Arbeitsgenosse, der damals meine Wegfahrt teilte und an dem gleichen Werke stand, weilt nicht mehr hienieden oder hat anderwärts den Kreis seines Wirkens gefunden. Doch, wenn auch die Zeiten schwinden und mit ihnen unsere Spuren sich verwischen – das Werk, an dem wir damals Hand anlegen durften, ist und bleibt dasselbe Gotteswerk, an dessen Wachstum und Gedeihen wir uns freuen. Herr, dein Reich komme! b) Ein Gewittersturm.Die Fast jeden Abend blitzt's und donnert's, bald in der Ferne, bald über unsern Häuptern. Schon sind einige schwere Gewitter über die Station Begoro im weiten Gebirgskessel hinweggezogen. Alle Fässer sind mit Regenwasser gefüllt. Die heftigen tropischen Regen haben die in der Zeit des Harmattans so schön hergestellten Wege der Station wieder zerrissen und die Erdkrume den Berg hinuntergeschwemmt. In der Stadt sind den Faulenzern ihre alten Hütten zusammengestürzt und ein reges Leben ist in die gesamte Bewohnerschaft gefahren. Alles repariert (16 ≡) Dächer und Häuser, um einer Überschwemmung ihrer winzigen Wohnräume vorzubeugen. Leider ist auch schon die Nachricht von einigen Außenstationen eingetroffen, daß da eine Kapelle, dort ein halbfertiges Lehrerhaus, das Werk mühsamer Gemeindearbeit, zusammengestürzt und in einen großen Lehmhaufen verwandelt sei. Schon sind zum Entsetzen des reisenden Missionars einige Bäche und Flüsse über die Ufer getreten, und die Wege sind zu Sümpfen und Morästen geworden. Aber dafür grünt und blüht nun auf den Pflanzungen der Pfeffer, Kaffee und Kakao. Die blühenden Orangen- und Limonenbäume strömen ihren starken betäubenden Duft aus, und auch die Öl-, Kokos- und Fächerpalmen bleiben hinter dem allgemeinen Sprossen und Blühen nicht zurück. Die Luft ist heiß, feucht und dämpfig. Im Wald macht sich der Modergeruch von verwesenden Pflanzenstoffen bemerklich, und überall steigt der unangenehme Erdgeruch auf.
Es ist Nachmittag. Die Bewohner des Missionshauses stehen miteinander auf der Veranda und schauen nach dem östlichen Horizont aus. Dort beginnt sich ein prächtig schauriges Naturspiel zu entwickeln: schwarzes Gewölk bricht aus der hinteren Ecke der Talmulde hervor; unheimlich jagen die Wolken an den Bergketten entlang, und über die unbelebte, in dämmerndem Halbdunkel daliegende Waldregion der Schluchten ziehen in rasender Eile die schwarzen Wolkenmassen dahin, gerade auf den Stationshügel zu. Mit dumpfen Echo bricht sich der Donner an den Bergwänden; flammende, bläulichrote Blitze sind seine Begleiter. Ein (17 ≡)
furchtbarer Macht aus der Höhe zu Boden geschleudert, daß es kracht und dröhnt. Und nicht besser ergeht es seinem Gefährten, dem alten Seidenwollbaum; der muß seine Federn lassen. Wie bei einem Schneesturm der Schnee, so stöbern seine weißen Seidenwollflocken in den Lüften herum und verwandeln die Gegend wie in eine Winterlandschaft. Der Sturm wird immer ärger. So schlimm war's noch nie, sagen die Missionsgeschwister ängstlich zueinander. Und nun rauschen auch noch die schweren Regenschauer auf das Dach herab, daß es klingt und tönt. Wie eine wilde Jagd fegt der Sturm auf der Bühne herum, daß die Balken knarren. Nun ein Donnerschlag, krachend und prasselnd, daß das ganze Haus erzittert. Dann wieder Blitz auf Blitz, Donner auf Donner, so daß es den Bewohnern ist, als ob sie sich mitten in einer schrecklichen Kanonade befänden. Und immer noch kein Ende; immer noch tost und heult der Sturm. Einer der Missionare versucht es, über die Veranda zu gehen; er wird aber vom Sturm und Regen zurückgetrieben. Plötzlich hört man von der Mittelschule her ein schrilles Pfeifen und Krachen, dann den dumpfen Fall von irgend etwas Schwerem. Doch schon übertönt das Heulen des Sturmes alles andere. Ach Herr, sei uns gnädig und hilf uns! seufzen die Geschwister. Endlich läßt des Sturmes Gewalt nach; nur noch der Regen flutet herab. Die Geschwister eilen hinaus, in der Richtung, von der sie den schweren Fall gehört. Sie sind bald darüber im klaren. Da steht das ganze lange Schulgebäude ohne Dach vor ihren Augen. Mit unheimlicher Gewalt hat der orkanartige Sturm das schwere, 35 Fuß lange Wellblechdach aufgehoben, wie einen Ball in die Höhe geworfen und weit ab in die Plantage hinein auf die Palmen geschleudert. Wie Zündhölzer sind die armdicken Sparren zerknickt, wie Papier das Wellblech zerrissen. Aber gottlob, kein Menschenleben ist dabei zu Schaden gekommen; es hätte noch viel schlimmer sein können! (18 ≡)
Das Haus freilich ist schwer vom Regen mitgenommen; seine Reparatur erfordert wieder Extrakosten, und bei dem chronischen Defizit schreibt man nicht gern ans Komitee um finanziellen Beistand. Noch eine andere Sorge bewegt die Missionsleute; der junge Missionar ist noch unterwegs auf der Predigtreise; er muß im Urwald nun gerade ins Gewitter gekommen sein. Wie ist's ihm gegangen? wo ist er jetzt mit seinen schwarzen Begleitern? Das tropische Gewitter war schnell und plötzlich hereingebrochen, ebenso schnell ist es auch wieder vorüber. Am Abend vergoldet die untergehende Sonne mit ihrem letzten Schein die Kuppen und Kämme der Berge von Begoro. Und als bereits die Nacht ihren dunkeln Mantel über Berg und Tal treibt, langt auch mit nassen Kleidern und knurrendem Magen der junge Stationsgenosse an. Lebhaft berichten seine Begleiter, die stämmigen Waldsöhne, von erlebter Durchhilfe Gottes: sie hätten ihren „Owura“ (Meister) gerade in der Hängematte getragen, als nur ein Meter vor ihnen, vom Sturmwind entwurzelt, ein Baum gerade über den Weg gestürzt sei – um haarbreit hatte der Tod sie und ihren Herrn gestreift. So war genug Grund zum Danken noch geblieben, und bei der Abendandacht gaben die Missionsgeschwister dem im Lied Ausdruck, indem sie miteinander sangen:
III. Etwas über Schlangen, Leoparden und Wanderameisen.Nicht wahr, lieber Leser, da bekommt man schon eine Gänsehaut, wenn man nur den Titel liest; eine gefährliche (19 ≡)
Eine Termitenburg. Gebäude von weißen Ameisen aufgeführt.
(20 ≡) Gesellschaft – und unwillkürlich denken wir dabei an einen langen Säbel, ein geladenes Gewehr und ein mächtiges Feuer; mit dem Säbel schlagen wir der Schlange den Kopf ab, mit dem Gewehr vertreiben wir den knurrenden Leoparden, und das Feuer verjagt uns auch die bissigen Wanderameisen. Wenn man nur immer alles gleich bei der Hand hätte; aber damit geht's oft wie mit dem Geld: es ist nicht da, wenn man's braucht.
a) Die Schlangen. Die Schlangen spielen in Afrika eine große Rolle; überall gibt's solche, bis in unsere Häuser dringen sie, und oft wenn man sie ergreifen oder totschlagen will, sind sie mit Blitzesschnelle und großer Behendigkeit auf und davon; nicht umsonst sagt das Wort, ihre Schlauheit vergleichend: „Seid klug wie die Schlangen.“ Meine erste Begegnung mit Schlangen hatte ich im Urwald; ich hatte einen langen Stock in der Hand und ging auf dem schmalen Fußpfad meinen schwarzen Begleitern voran;
Schlangen Nicht lange danach, ich war mit meinem Freund Missionar Lädrach zusammen, bekamen wir in unserem Hühnerhof Besuch von einer schwarzen Schlange; über 150 Zentimeter war sie lang, und stolz kam sie daher, bis die Prügel der Schüler auf sie herabregneten und einer ihr mit dem Buschmesser den Kopf abschlug. Der Kopf wird dann jeweilen (21 ≡) an eine Holzgabel gesteckt und diese irgendwo aufgehängt, bis der Schlangenkopf recht ausgetrocknet ist. Dann wird er herabgenommen – aber vorsichtig natürlich – und in einem Mörser mit allerlei Pflanzen und Heilkräutern zusammengestampft, und dann wird diese „Arznei“ von einem Jäger eines Morgens mit etwas Palmwein geschluckt, damit er in Falle eines bösen Schlangenbisses nicht sterben müsse.
Im gleichen Jahr vernahm ich eines Abends vor meinem Haus ein langgezogenes wehmutsvolles Trauergeheul. Wie ich hinausgehe, kommt ein langer Zug von klagenden Weibern und trauernden Männern daher, und in einem alten schmutzigen Tuch, das an einer Stange getragen wird, liegt zusammengekauert und tot eine Frau – von einer Schlange gebissen! 20 Minuten nach dem Biß war sie schon tot! Einer unserer Hängematteträger schüttelte eines Abends noch vor dem Schlafen sein einziges Kissen zurecht; es kam ihm vor, es sei nicht so weich wie sonst. Nun, das Schütteln war auch nötig, denn eine Schlange hatte sich tagsüber darein gelegt und sprang nun zischend heraus. Die Einmal war auf der Treppe in Begoro eine Schlange und oft schoß ich eine mit der Kugel von einer Palme herunter. Auf den Palmen halten sie sich überhaupt gerne auf. Da erinnere ich mich an einen Neger, der auch eines Tages auf eine Palme heraufkletterte, um Ölkerne abzuernten. (22 ≡) Wie er aber schweißtriefend oben anlangt, da fährt mit wildem Gezische eine große Schlange auf ihn los. Er aber, auch nicht faul, schlägt mit seinem scharfen Messer nach ihr und haut ihr auch richtig den Kopf ab. Aber leider trifft das scharfe Messer auch das Kletterseil, das ihn trägt – und mit einem Schrei des Entsetzens fällt er hinunter, und abends findet man ihn als Leiche im stillen, dunkeln Urwald draußen.
Wieder einmal, ich war damals in Begoro, im Innern, machten wir, zwei Engländer, Missionar Lädrach und ich, einen Ausflug mit unsern schwarzen Schülern zu einem berühmten Felsen. Plötzlich rufen unsere Schüler wild durcheinander: „Owo o, owo o; owo o!“ Und was für eine Schlange, ein großes Prachtexemplar! Ich hatte gerade einen Speer in der Hand und hatte fast im Sinn, sie auf den Boden anzuspießen, als sie unversehens von einem Neger am Halse gepackt und kräftig gehalten wurde.
Die Auch Riesenschlangen haben wir auf der Goldküste, und ich habe schon welche gesehen, an der drei bis vier Männer genug zu tragen hatten; natürlich war sie vorher getötet worden. Die Riesenschlange hat keine Giftzähne, sondern umringt und erdrückt ihre Opfer. Einer unserer Goldküste-Missionare war auf der Reise (23 ≡) und lag für ein Stündchen in der Hängematte. Nun kam eine schwierige Stelle, kreuz und quer lagen Bäume über dem Weg, und die Träger kamen kaum durch mit der Hängematte. Der Missionar sagte: „Halt, ich will wieder eine Strecke gehen.“ – „Nein, nein, Meister,“ lautete die Antwort der Neger, die die Hängematte trugen, „bleib’ nur liegen, es geht schon zur Not!“ Aber der Missionar hatte eine unerklärliche Unruhe und sprang aus der Hängematte. Eine halbe Minute darauf lag auf dem Kopfkissen in der leeren Hängematte eine gefährliche Schlange! War das nicht eine sichtbare Bewahrung Gottes? Die Schlange war von einem Baum, an den die Hängemattestange hingestoßen war, heruntergefallen und hätte den Missionar unfehlbar getötet, wenn er noch darin gelegen hätte.
Als Frau Missionar S. einst in Kamerun abends noch Wasser am Waschtisch trinken wollte, sah sie, wie eben eine Schlange aus der Waschschüssel Wasser schlürfte. Ihr Mann schlug sie tot. Doch am nächsten Morgen lag eine zweite in der Schlafstubenecke, die er auch tötete. Nachmittags erschien eine dritte, und als er nun nachsah, fand er in der Wand ein Loch, das weitere 11 Schlangen barg! Die (24 ≡) und gewahrte mit Schrecken den zusammengeringelten Leib einer großen Schlange. Im Nachtkleid flieht sie und ruft um Hilfe. Alles im Hause eilt herbei, aber keiner wagt, mit einem Stecken vorzugehen. Da kommt der Koch mit der Flinte – er ist Retter in der Not. Er zielt bedachtsam durch das Fenster auf das Untier – aber – er drückt nicht ab. Er geht schelmisch lächelnd in die Stube und bringt zum allgemeinen Entsetzen unterm Arm die vermeintliche Schlange mit: es war nur eine herabgefallene Schlummerrolle gewesen!
b) Leoparden.Neben den Schlangen war mir das unangenehmste Tier der Leopard. Die Neger nennen ihn manchmal den Feuerkönig, wohl wegen des unheimlich feurig leuchtenden Blickes. Diesen Blick habe ich noch gut im Gedächnis, als im feierlich stillen Urwald einst ein Leopard unsern Pfad kreuzte; auch klingt mir noch heute das knurrende katzenartige Gebrüll jenes Leoparden im Ohr, der unser Nachtlager im Wald umschwärmte; nur ein gut unterhaltenes Feuer hielt ihn von einem Antrittsbesuch bei uns ab. Wir Missionare sehen oft die gräßlichen Verwundungen, die diese Bestien den schwarzen Jägern zufügen, wenn man die übelzugerichteten, zerfleischten Menschen zu uns bringt, damit wir uns ihrer erbarmen und sie womöglich heilen. Kampf mit (25 ≡) Priester (= Zauberer, Medizinmann) das Schreien, er eilt herbei und behauptet, seine Fetischmedizin könne den Leoparden töten; aber bald liegt auch er am Boden, und nach ihm noch ein vierter Neger; zwei starben, die andern zwei waren lange siech und wund.
In Nsaba bauten wir vor Jahren auch einmal eine kräftige Leopardenfalle aus Bambus und beschwerten sie mit Steinen. Eine Ziege und ein Schaf wurden abwechslungsweise als Lockköder verwendet und in die Falle hineingetan; doch durch eine sinnreiche Einrichtung war der Leopard verhindert, das Schaf oder die Ziege anzugreifen. Vier Wochen warteten wir der Dinge, die da kommen sollten, aber der „Monsieur Leopard“ war schlau genug, nicht in die Falle zu gehen, was ich an seiner Stelle auch nicht getan hätte. Aber in jenen vier Wochen wurden in Nsaba nächtlicherweise nicht weniger als 40 Schafe und Ziegen geraubt.
Guter Jäger, die den Leoparden siegreich bezwungen, gelten als mutige Leute und mit Recht. Das Fell wird in der Regel dem Häuptling des Dorfes geschenkt, der dem tapferen Jäger ein Gegengeschenk in Geld gibt. Die Tatzen und scharfen Krallen werden gar zu gerne von den Mohammedanern und von den Fetischpriestern gekauft, um allerlei „kräftige“ Amulette, d. h. Zaubergeräte daraus zu machen, und diese Zaubergeräte werden dann zu hohen Preisen verkauft. Auch die Beinknochen und der Schädel des Leoparden wandern viel und oft in den Fetischtempel (26 ≡) oder werden draußen beim Dorfeingang aufgehängt, um allerlei Unheil zu bannen.
Fang mit Amulette. Einer meiner heidnischen Freunde hatte ein Amulett (Schutzgott), das ich einst aufmachte. Es war ein großer Leopardenzahn drin und ein Stück Leopardenfell dabei, in das ein großes Stück Papier eingenäht war. Auf dem Papier waren viele Quadrate und Kreise und Rechtecke eingezeichnet, und in diese Figuren sind allerlei Anrufungen, Beschwörungen und Buchstaben in arabischer Schrift eingeschrieben gewesen. Das Ganze sollte gut und nützlich sein und Leopardenstärke besitzen zur Abwehr etwaiger Feinde und Widersacher. Auch Negerkinder trifft man dann und wann, die einen Leopardenzahn an einer Schnur um den Hals tragen, oder Soldaten, die einen Leopardenzahn am Handgelenk befestigen, damit kein böser Einfluß oder eine feindliche Kugel sie je gefährden könne! Ich erinnere mich auch, gesehen zu haben, daß, wenn ein Leopard getötet wird, der Jäger gewisse Vorschriften zu befolgen hat, z. B. mit Palmöl die Schußwunde bestreichen, weiße Erde auf den Kopf des getöteten Leoparden streuen usw. Das hängt eben damit zusammen, daß (27 ≡)
die Vorstellung da ist, es habe vielleicht ein Geist in dem Leoparden seine Wohnstätte gehabt. – Mit seinem Fell werden die Kriegstrommeln überzogen und für die Könige und Häuptlinge werden Kriegsmützen daraus gemacht.
Der Fetisch Odente von Date bei Akropong. In dem Lehmhaufen wurde seinerzeit ein Knabe lebendig als Götzenopfer begraben.
Und wie die Asanteer vor langen Jahren das Herz des tapferen englischen Gouverneurs M’Carthy gegessen (28 ≡) haben, um sich dessen Heldenmut anzueignen und aus seiner „Seelenstärke“ Nutzen zu ziehen, so kommt es auch heute noch vor, daß ein Neger etwa das Herz des Leoparden verzehrt, um die Vorzüge dieses Tieres zu erben und sich übernatürliche Stärke zu verschaffen.
Das erinnert mich aber daran, daß nicht nur die Zähne des Leoparden, sondern auch des Menschen eigene Zähne von den Negern als Zaubermittel verwendet werden. So konnte es vorkommen, daß, wenn ich in Afrika einen Zahn auszog und derselbe etwa auf den Boden fiel, ihn der Besitzer sorgfältig auflas und ihn sich nachher um das Handgelenk oder seinem Kinde um den Hals hängte; denn nach seiner Anschauung ist drin ja Seelenkraft, Lebensstoff enthalten und darf nicht so leichthin verschwendet werden. So ist auch Seelenstoff im Haar, und deshalb wird das Haar des Negers, wenn es ihm abgeschoren wird, nicht schlechtweg weggeworfen, sondern in die Fugen und Nischen der Lehmhütte hineingestopft. c) Von Wanderameisen. Ein Tierchen, das einem das Leben in Afrika besonders erschwert, ist die Ameise, hierzulande geschätzt unter dem Gesichtspunkt: „Geh’ hin zur Ameise, du Fauler, und lerne von ihr“. In Afrika hat sie keinen so guten Ruf. Es gibt dort alle möglichen Arten; da sind die ganz winzig kleinen, die oft der Missionarsfrau in deren Speisekammer Verheerungen anrichten.
Gefräßige (29 ≡) die Balken in kurzer Zeit aus, daß sie wie Strohhalme sind, und das Haus würde wie ein Kartenhaus zusammenplumpsen. Wenn ein Invalide mit einen hölzernen Bein sich auf der Goldküste am Boden schlafen legte, so könnte es ihm passieren, daß ihm sein Bein des Morgens weggefressen wäre. Schlimm ist es auch, wenn sie den Korkzapfen aus der Flasche herausnagen. Mir haben sie einst auch die Hängemattestange ausgehöhlt, und zwischen Begoro und Oseem bei Akem lagen infolgedessen plötzlich die schwarzen Träger und der weiße Missionar übereinander am Boden – die Stange war schön in der Mitte gebrochen; als junger Missionar hatte ich zu wenig aufgepaßt, und wer nicht aufpaßt, muß ja immer dafür büßen, das ist eine alte Wahrheit.
Die (30 ≡)
Nächtliches Im Jahre 1900 oder 1901 mußte einer unserer Christen (31 ≡)
von Nsaba aus der Gemeinde ausgeschlossen werden, weil er sich nicht mehr um Gottes Gebote kümmern wollte. Trotz allen Ermahnungen sank er von Stufe zu Stufe und verlegte sich zuletzt auch noch aufs Stehlen. In einer dunkeln Nacht nahm er einen Sack und erkletterte auf der Plantage eines Nachbarn einen Kolanußbaum; aber o weh! er muß ausgeglitscht sein, fiel herunter und konnte sich nicht mehr fortbewegen. Niemand wußte, wo er war und wie elend er dran war. Fünf Tage später war ich gerade im „Königshof“ in Nsaba, als zwei Negerbuben dem „König“ Jaw Duodu meldeten, daß im Urwald draußen ein Leichnam liege und von den Wanderameisen fast aufgefressen sei! Schnell ging ich mit dem schwarzen König hinaus nach der bezeichneten Stelle, aber wir konnten unmöglich an den Leichnam herankommen. Millionen und Millionen von Wanderameisen hatten sich da eingestellt und bedeckten den Leichnam, den sie bereits ganz angefressen hatten. Und es bestand kein Zweifel, daß der Dieb, eben jener Mann, der sich vom Missionar nicht warnen lassen wollte, der vermißte Mann war und vor uns lag. Um seine Leiche zu bergen, mußten die Wanderameisen zuerst mit großen Feuerbränden verscheucht werden. Das war ein Ende mit Schrecken; niemand konnte sagen, ob nicht die Ameisen ihm in Mund, Nase und Ohren hineingekrochen waren, bevor er tot war; möglich wäre das schon. Wie mag es denen zumute gewesen sein, denen man früher Hände und Füße gebunden und sie dann lebendig den Wanderameisen zur Beute hingeworfen hatte! Das ist so recht heidnisch, und mahnt uns zum Schluß, nun über den Schlangen, Leoparden und Wanderameisen die Menschen im Heidenlande nicht zu vergessen; denn der Mensch ist doch die Krone der Schöpfung und steht über den Tieren. Wenn auch die Tiere ein „Seelenleben“ führen, so hat der Mensch doch eine unsterbliche Seele, die die Tiere nicht haben. Deshalb gehen wir hinaus (32 ≡) nach Afrika nicht als Tierfreunde, sondern als Freunde der Schwarzen, um ihnen das Evangelium zu bringen, und ich hoffe, daß viele meiner großen und kleinen Leser und Leserinnen auch recht oft und viel als Freunde des schwarzen Mannes die Sache der Mission fördern, so gut sie es können, mit Herzen, Mund und Händen.
IV. Heidentum: In der Blutstadt Kumase.Gefangen (33 ≡)
Berüchtigte Scharfrichter von Kumase.
(34 ≡) Jahren gründlich kennen. Oft sahen sie die Scharfrichter, die schwarzen Gesichter noch mit Kohle bemalt, die Messer im Gürtel, umhergehen; sie sahen die Menschenschädel, womit die Trommeln, die menschlichen Kinnladen, womit die Blasinstrumente geschmückt waren; sie sahen jenen gewaltigen Messingkessel, dick mit Menschenblut überschmiert und mit Löwenbildern und Kugeln geziert, der als Sitz eines großen Geistes göttlich verehrt wurde.
Ein (35 ≡) Kindergestalten. Was mußten sie erlitten haben und was mochte ihrer warten!
Befreiung. Als im Januar 1874 ein englisches Heer über die Grenzen von Asante rückte und unsere Gefangenen vom König Karikari entlassen waren und der Freiheit entgegeneilten; als plötzlich in der Wildnis der Zug hielt und Ramseyers dem ersten englischen Offizier gegenüberstanden, da waren sie wie die Träumenden. Aber freilich, was war mit ihren Leiden für Asante erreicht? Kumase hatte jetzt eine christliche Gemeinde gehabt, bestehend aus den gefangenen Europäern und einigen schwarzen Christen, die ebenfalls dort festgehalten wurden. Ramseyer durfte in seiner Behausung Gottesdienst halten, später auch in den Straßen predigen, und jedermann hatte Zutritt. Ein Häuflein Kinder ließ sich herbei, zur Schule zu kommen, und lernte wenigstens ein paar Lieder singen. Auch hatten die Gefangenen hie und da Gelegenheit, an jenen verschmachteten Sklaven christliche Barmherzigkeit zu beweisen, wenigstens mit dem Erfolg, daß sich die Kumaser und ihr König über diese seltsame Regung verwunderten. Aber bekehrt war niemand; Fetischdienst und Menschenopfer gingen fort. Im Jahre 1881 machten wieder zwei Basler Missionare einen Besuch in Kumase. Beim Eintritt in die Stadt führte ihr Weg über ein frisches Grab; rechts davon stand ein Topf mit Blut, links war ein lebendiges Schaf mit Hölzern an den Boden gespießt. In dem Grabe lag ein Mädchen, das man geopfert hatte, um den Besuch der Weißen unschädlich zu machen. Missionar Huppenbauer beschreibt die Begrüßung beim König recht anschaulich also:[GWR 2] Der
Heiden- 20 Jahre später, 1901, bin auch ich dort in Kumase eingezogen, als einer der ersten Weißen, der es wagte, nach dem Aufstand der Aschantis und nach gewaltsamer Öffnung des Landes durch ein englisches Heer dorthin zu zu gehen, zugleich um im Auftrage der Mission wieder Verbindung mit den Häuptlingen anzuknüpfen. Der Aschantistolz ist jetzt gründlich gebrochen, der Tyrann und König deportiert und eine neue Zeit beginnt für Aschanti:
Heute steht auf demselben Platz der Aasgeier, wo wir noch damals etwa 5000 Menschenschädel bleichen und die Aasgeier an Knochen von verstümmelten Menschen haben herumnagen sehen, die Kirche unserer Mission und ihr (38 ≡) schlanker Turm zeigt in die Höhe; neben der Kirche liegen Schulen und Missionsstation, Faktoreien und Regierungsgebäude, ein Morgenrot dämmert dem Volk, es ging durch Nacht zum Licht.
V. Missionsarbeit.a) Durch Predigt und Krankenheilung.Gewiß werden nun manche Leser von meinen Missionserlebnissen unter diesen Negern, meiner Arbeit an ihnen Näheres wissen wollen. Die Arbeit des Missionars besteht in der Hauptsache aus dreierlei: Predigt des Evangeliums, Schularbeit und praktischer Liebestätigkeit; in Heilung des leiblichen Elends. Aus dieser dreifachen Tätigkeit mögen einige Erlebnisse folgen: Bei den (39 ≡)
„Wie wir den Heiden predigen.“
(40 ≡) einäugigen Hausbuben Kyame – er hieß sich meistens Albert, wie ich – Kaffee machen. In jedem Dorfe herrschte eine Frau, eine Häuptlingin; abends versammelte sie ihr Volk unter den Schattenbäumen des Marktplatzes, um zu hören, was der Obroni, der Europäer, ihr zu sagen habe. So zog ich denn im Gänsemarsch mit meinen sieben schwarzen Begleitern dorthin, wo sich mir ein farbenprächtiges Bild darbot: die Häuptlingin saß auf einem mit Goldblech beschlagenen Stuhl; hinter ihr standen drei herkulische Neger, die einen seidenen Schirm über der Fürstin schwangen, das Zeichen ihrer Würde; vor ihr auf dem Boden lagen die Hofnarren, verkrüppelte Zwerge und Albino- (weiße) Neger und Kinder mit Goldschildlein auf der Brust; rechts und links von ihr standen die großen Kriegstrommeln, an denen die Schädel von gefallenen Feinden hingen. Die Frau war sehr grausam, sie hatte während des Aufstandes der Aschantis gegen die Engländer (1900) viele Sklaven töten und ihr Blut über die Götzen schmieren lassen, um sie zu verhöhnen und Heil und Sieg ihrem Land zu verschaffen. Im Hintergrund standen die Krieger, alle mit roter Farbe angestrichen, dann die Weiber und Sklaven. Ja, liebe Freunde, was hätte ich nun diesen armen, vom Fetisch geknechteten Menschen bringen sollen? Da sagt einer: Kultur und Zivilisation! Ganz recht, – das kommt durch uns und unsere Schularbeit – aber für die Neger bedeutet Der Alkohol. unsere Kultur oft nur Schnaps; im Jahre 1906 kam auf die Goldküste für 8 Millionen Mark Schnaps. Nach der Regierungsstatistik hat die Zufuhr seither um 7 Millionen zugenommen, so daß der Wert des eingeführten Branntweins jetzt 15 Millionen Mark im Jahr beträgt. Wer aber weiß, wie schädlich das Schnapstrinken ist, ahnt, wie dadurch die armen Negervölker entkräftet werden. Wer weiß, was es heißt: gott-los, friede-los, glaubens-los, hoffnungs-los zu sein, wird die Heiden nicht glücklich nennen; wer nun aber noch zusehen muß, wie man ihnen (41 ≡) alle die schlechten Erzeugnisse unserer Kultur auch bringt, wird sie bedauern.
Seht, da war ich so froh, daß es hieß: ihr werdet Gottes Zeugen sein! – und freudigen Herzens predigte ich über jenes unvergleichliche Jesuswort: „Also hat Gott die Welt geliebt“, Joh. 3, 16. Am Schluß meiner Ansprache glänzte eine Träne im Auge der wilden Häuptlingin, und sie sagte zu mir: „Europäer, dein Wort ist mir süß, sende mir einen Lehrer, daß ich noch mehr von der guten Botschaft vernehme!“ – und vor einigen Jahren durften wir dorthin einen Lehrer senden, einen schwarzen; er hält Werktags eine kleine Schule ab und zeugt vom Herrn Sonntag für Sonntag; an Weihnachten hatte er die Freude, daß einige Männer, die einst ihre Hände besudelten im Menschenopfer und nachts bei den schändlichen Mondscheinfesten die Schnapsflasche von Mund zu Mund gehen ließen, sich gründlich bekehrt haben. Mission (42 ≡) ich auch, denn die Wundränder sind verbrüht! – und dann?“ „Ja, dann habe ich, wie du siehst, Pfeffer draufgeschmiert und Lehm und das Ganze mit Bast zusammengebunden; aber Herr, 's wird nicht besser, hilf mir doch, ich bitte dich, sonst stirbt mein Kind – du hast ja erst neulich meinem Onkel einen Zahn gezogen, ach hilf doch auch mir!“ – Nun, da habe ich nicht gepredigt, sondern nur dem Kind die Wunden gewaschen, Medizin draufgetan, und meine Frau – die auch mit mir in Afrika war und Freud und Leid des afrikanischen Missionslebens treu und aufopfernd mit mir teilte – gab der Mutter zur besseren Ernährung des Kleinen eine Büchse Hafermehl und kondensierte Milch – denn sonst gibt's ja keine Milch dort für die kranken und gesunden Negerkinder. Nach sechs Wochen kam die Frau freudestrahlend: „Herr, ich danke dir, mein Kind wird wieder gesund!“ – Und ein halbes Jahr später kam sie wieder mit dem Jungen, diesmal an der Hand: „Afei mepe se mesom Onyame!“ ruft sie, „jetzt möchte ich auch Gott dienen, dem Gott, dem ihr dient; das muß ein Gott der Liebe sein, der euch die Liebe lehrt!“
Ärztliche So schreibt erst kürzlich ein Freund von mir, der im Innern Deutsch-Togos unter dem Volk der Dagomba seit einem Jahre (Dezember 1912) arbeitet:[GWR 2] Samariter-
Ähnliches schrieb uns ein anderer Freund aus Kamerun, aus dessen Brief einiges dem lieben Leser zu schildern ich mich nicht enthalten kann:[GWR 2] Heidnische
Aber- (47 ≡)
dieses Mannes herbeizuführen. Ich redete dann den Leuten zu, sie sollten nur keine Angst haben, ich werde
Die Missionarsfrau als Krankenpflegerin.
(48 ≡)
Ja, wenn der Missionar nicht da wäre, dann wären wir schon lange alle tot, sagte ein anderer. Die Leute glauben immer, ich habe alle Mittel, um Krankheit und Tod zu bannen. Sie haben ein merkwürdiges Zutrauen zu mir. Da kommt ein alter Christ von Ndogmbog. Er hatte Beschwerden im Unterleib. Ich gab ihm Medizin. Er nimmt sein Fläschchen, guckt es lange an und meint: „Sieh, Missionar, in meinem Bauch ist es schon lange nicht mehr richtig, darum meine ich, du solltest mir den Bauch aufschneiden, dann könntest du wieder alles in Ordnung bringen.“ Ich winkte ihm natürlich ab und sagte: „Das Bauchaufschneiden tut sehr weh und kostet viel Geld. Geh' nur heim und brauche zuerst einmal deine Medizin; zum Bauchaufschneiden ist's immer noch Zeit.“ b) Durch Arbeit an der schwarzen Jugend.Eine weitere überaus wichtige Arbeit erwächst der Mission an der Jugend; wer die Jugend hat, der hat die Zukunft! Hat man oft an den Alten in Afrika viel auszusetzen, die Kinderwelt kann man herzlich liebgewinnen; schon die Kleinen und Allerkleinsten ziehen uns an. Eltern und (49 ≡) selbst eine leckere Mahlzeit. Auch Erd- oder Palmnüsse lassen sich schnell bei einem Negeronkel oder einer Negertante zusammenbetteln, um eine gute Erdnußsuppe oder Palmölsuppe zu brodeln, und wo der Salzsack liegt und der Pfefferkorb hängt, das wissen die Negerbuben sehr gut. Nur kann es dann wohl vorkommen, daß die Negermutter den kleinen Schlingel gleich zu fassen bekommt, wenn er seine Hände in den Salzsack steckt – und dann o weh! Hat der Kerl sich vielleicht sonst schon allerlei zuschulden kommen lassen, dann hat die Mutter kein Erbarmen mit ihm. Sie reibt ihm afrikanischen Pfeffer in die Augen, und daß das schrecklich weh tut und das Schmerzensgeschrei des Gestraften nach einer Stunde noch nicht aufhört, das könnt ihr euch denken! Ich weiß von einem Kind, das mit einer Mischung von Salz, Zwiebeln und Pfeffer eingerieben wurde, weil es die Mutter nicht auf den Acker begleiten wollte. Und weil eines Negerkindes Haut fast immer voll von Schrunden und Rissen und allerlei Ausschlägen ist, so muß das ungehorsame Kind, das so bestraft wurde, furchtbar gelitten haben.
Afrikanische In ähnlicher Weise wird mit ihnen verfahren, wenn sie Leibschmerzen haben. Manchen großen Negerbuben habe ich davonspringen sehen in den Wald hinaus, wenn die Mutter oder der Vater rief: „Kofi, komm schnell, wir wollen dir Arznei eingießen!“ Ich wäre auch davon gesprungen. (50 ≡) Einst wurde einem Schüler ein abgeklaubter Maiskolben in den Mund hineingeschlagen, damit der Quacksalber ihm die Arznei daneben hinuntergießen könne, weil er den Mund nicht mehr aufmachen konnte. Ein anderes Mal kam ich dazu, wie einem sterbenden Kinde Feuer unter den kalten Füßen angemacht wurde, so daß es laut aufschrie. Einem anderen Kinde, das an Kopfweh litt, hatte der schwarze Arzneimann einen Stein auf den Kopf legen lassen, und zwar keinen kleinen. Zu einem kleinen, neugeborenen Kinde, das nicht recht atmen konnte, wurde einmal ein Quacksalber gerufen, der das arme Büblein so lange räucherte, bis es gar nicht mehr atmete. Wie manches Negerkind wird von oben bis unten oder auch nur an den Händen, Armen und Beinen, etwa auch am Rücken oder am Rumpf mit einem Messer geritzt und geschnitten, 10-, 20-, 30-, ja 50- und 100mal und noch mehr; dann werden in die Schnittwunden noch scharfsaure Salben und Brühen gerieben; das verursacht oft große Schwellungen und fürchterliche Wunden. Noch immer muß ich an jenes arme Negermädchen denken, dessen Wunde noch nicht gereinigt war, trotzdem man einige Kessel Wasser darüber geleert hatte; und noch meine ich das Jammergeschrei jenes Negerjungen zu hören, dem man einen Rippenbruch mit den Füßen massierte! Ich habe sicher nicht unrecht, wenn ich sage, daß die kranken Kinder in Europa es viel, viel besser haben als die Negerkinder.
Lern- (51 ≡) Unsere Basler Mission hat allein in Afrika 27000 Schüler und Schülerinnen. Die Negerjugend ist von einem großen Lerneifer ergriffen; der Andrang zu den Schulen wird immer größer; allein in Kamerun ist die Zahl der Schüler 1912 um etwa 4000 gestiegen. Beim Beginn des neuen Schuljahres drängten sich auf einer Missionsstation diesmal nicht nur die Lehrer, sondern auch Mütter und Großmütter zum Mittelschulvorsteher und bestürmten ihn mit Bitten, er möge ihre Jungen aufnehmen. Eine Frau schwang, während sie auf ihn eindrang, wie drohend ihre geballte Faust; es wurde ihm fast bange, sie könnte nächtens zu Tätlichkeiten übergehen; hinterher stellte sich aber heraus, daß sie in ihrer Hand ein Fünfmarkstück, das Eintrittsgeld, versteckt gehalten hatte. Eine andere erwiderte, als er sie auf den Raummangel hinwies, sie werde ihrem Jungen jeden Tag einen Schemel mitgeben, so werde er niemand den Platz versperren. In den Schulen wird tüchtig gearbeitet. In vielen Schulen werden die Jungen täglich ein paar Stunden in die Plantagen geschickt, um dort selbst ihr Essen oder allerlei Ausfuhrprodukte anzupflanzen. In Bamefut, einer Außenstation von Bali, griffen die beiden Söhne des dortigen Häuptlings wacker mit an; als sie sich deswegen von ihren Altersgenossen verspotten lassen mußten, gab der eine zur Antwort: „In Deutschland arbeitet jedermann, sogar der Kaiser!“ Der Appell an diese höchste Instanz mußte die Lästerer doch wohl zum Schweigen bringen. Auch Industriezweige sind in manchen Schulen eingeführt worden.
Es gibt natürlich unter der schwarzen Jugend auch manchen „Max“ und „Moritz“, manches unartige Kind, um so mehr als ja von einer richtigen Erziehung beim Neger nicht die Rede ist; wie soll er seine Kinder erziehen, der selbst nicht erzogen ist.
Brave Ein braver schwarzer Bube war z. B. ein Junge von (52 ≡)
14 Jahren namens Kwaku. Seine Eltern lebten in Akra an der Küste. Eines Tages nun berieten sich der Vater und der Onkel des Kwaku über seine Zukunft; sie beschlossen, daß er auf drei Jahre zu einem Fetischpriester in die Lehre getan werden solle, um dann als Fetischpriester sein Brot durch Lügen und Betrügen zu verdienen. Kwaku erklärte, das werde er nie tun, aber der Onkel sagte: „Du hast da überhaupt nicht dreinzureden; auch ist das Lehrgeld zum Teil schon vorausbezahlt, und in den nächsten Tagen werde ich mit dir zum Fetischpriester gehen.“ Aber Kwaku sagte zu sich selber: „Da wird nichts draus; ein Betrüger mag und kann ich nicht werden. Mit Affenpfoten und Wildschweinborsten, Schlangenhäuten und Leopardenzähnen, Eierschalen und Hühnerdärmen und anderen Zaubermitteln mag sich abgeben wer will, ich weiß etwas Besseres zu tun.“ Am nächsten Morgen hatte seines Vaters Hahn seinen Morgengesang noch nicht ausgekräht, als Kwaku schon auf dem Marsch war in der Richtung nach der Missionsstation Nsaba. Er fand bei einem christlichen Lehrer Aufnahme und ging von da an fleißig und wacker in die Schule. Es war ihm ein Anliegen, ein braver Mann zu werden und „Gott zu dienen“, wie er sagte. Schenkte man ihm ein Heft oder ein Buch, so war er sehr dankbar, und erhielt er gelegentlich eine Kerze, so „studierte“ er beim Kerzenschein bis in die späte Nacht hinein. Nach einiger Zeit kehrte er zu seinen Eltern zurück, und ich habe gute Hoffnung, daß aus ihm ein braver Mann wird. Leider ist er nicht begabt genug, um Lehrer zu werden, wie er gerne möchte. – Also, um brav und gut bleiben zu können, ist dieser Knabe seinen Eltern davongelaufen und hat als Junge in der Fremde sein Brot verdient zwischen den Schulstunden, wie das viele Negerjungen tun, wenn die Eltern ihnen nicht das nötige Geld geben können, um Bücher, Tafeln und Hefte usw. zu kaufen. Ich weiß von einem Negerjungen, zu dem sein heidnischer Vater sagte: „Wenn du Geld brauchst für allerlei (53 ≡)
Lumpereien und Bübereien, dann bin ich immer zu haben! Aber um dir Tafel, Bücher und Hefte zu kaufen, bin ich nicht da; da kannst du dich anderswohin wenden!“ Das heißt doch, einen Knaben geradezu ins Verderben führen, nicht wahr! Aber Kwablua, so hieß dieser Knabe, blieb brav, verdiente sich mit Lastentragen und Botengängen sein Schulgeld, und was er sonst noch zum Lernen brauchte. Er trat dann später in das Lehrerseminar der Mission ein und ist heute einer unserer bravsten Lehrer, den Heiden und Christen achten und liebhaben. Einer unserer Schüler, names Kwadwo, war bei einem Goldgräber, der ein böses Leben führte, in Dienst. Eines Tages trifft ihn sein Meister auf seiner Matte kniend und betend. „Entweder du hörst auf mit dem Beten oder du verlässest mein Haus!“ so schrie der Goldgräber den Jungen an. Am nächsten Morgen verließ Kwadwo das Haus seines Meisters; er wollte lieber auf den schönen Verdienst verzichten, als sich das Recht zum Gebet rauben lassen. Das war doch sicher ein braver Junge, ein Knabe, der weiß, was er will. Ich bin gewiß, daß noch viele unserer schwarzen Schüler ebenso gehandelt hätten. Aber auch brave Mädchen gibt's in Afrika. Es ist mehr als einmal vorgekommen, daß Kleider von Missionaren in die Wäsche gegeben wurden, in denen sich noch allerlei Geldstücke befanden; doch wurden diese regelmäßig von den jugendlichen Wäscherinnen zurückgebracht. Einst feierten wir ein Dankfest in der Kirche. Es wurde bekannt gegeben, daß von alt und jung so viel Dankopfer erwartet würden, als man eben leisten könne. Tags vorher stellten sich Mädchen und Buben bei mir ein: „Meister, wir haben nichts, um es morgen in den Gotteskasten zu legen; gib uns Arbeit, daß wir auch unser Dankopfer einlegen können!“ Was taten sie nun? Sie trugen Steine, Sand und rote Erde etwa vier Stunden lang, und das im heißen afrikanischen Sonnenbrand, und am Sonntag wanderten sie stolz und freudig mit dem buchstäblich erschwitzten (54 ≡) Lohn in die Kirche, um ihn „Gott zu geben“. Das ist doch recht nachahmenswert, nicht wahr? Ich hatte es als Bube leichter; denn meine Eltern gaben mir immer etwas mit für die Opferbüchse, so daß ich ohne Schweiß etwas einzulegen hatte. Diese Jungen und Mädchen haben mich damals recht beschämt.
Daß es unsern schwarzen Jungen nicht an sittlichem Ernst fehlt und sie wenigstens den guten Willen haben, dem nachzuleben, was sie in der Schule ans Herz gelegt bekamen, beweist die Abschiedsfeier in einer unserer Mittelschulen[1], bei der mein Freund K. stiller Zeuge war; die älteste Klasse sollte nach absolviertem Kursus die Anstalt in Bana verlassen, und es versammelten sich nun in aller Stille eines Abends die Schüler zur Abschiedsfeier auf dem Schulhof. Eine Ab- (55 ≡)
In der Unterrichtsstunde im Lehrer- und Predigerseminar in Akropong.
(56 ≡)
darauf: „Ich danke euch in meinem und meiner Klassengenossen Namen für diese Veranstaltung und für die denkwürdigen Worte meines Vorredners. Wir lassen euch zurück im Schutz und in der Pflege der Lehrer, die uns erzogen haben, und hoffen, ihr werdet stets gehorsam und demütig bleiben. Die Anforderungen an einen Schüler steigern sich von Jahr zu Jahr. Es wird daher nicht nötig sein, daß ich euch rate, hart zu studieren und auch den schwächeren Schülern vorwärts zu helfen. Laßt keinen nur spielen mit seinen Büchern und seiner Zeit, damit eure Lehrer alle weiter bringen! Wir wünschen euch guten Erfolg und machen euch hiermit ein Geschenk von vier Mark.“ Ein zweiter erhob sich und sprach: „Ich pflichte dem eben Gesagten bei. Ihr kennet auch alle den großen Spruch: Wissen ist Macht. Nehmet den euch als Motto, und versuchet, uns sogar darin zu übertreffen.“ Und dann begann der dritte: „Wir danken alle dem allmächtigen Gott, der uns so weit gebracht hat. Und euch schenke ich eine Schachtel Biskuits. Aber wohlverstanden, ich werfe sie vorwärts, der Stadt zu. Suchet sie also nicht hinter euch, im Busch bei der Quelle. In einem Lesestück heißt es: Begin and go on; („fang an“ und „fahre weiter!“); das soll das Losungswort der Banaschüler sein und bleiben. Drum vorwärts, nie rückwärts.“ Man sieht, die Schularbeit der Mission ist nicht umsonst. Doch ich muß schließen. Wir kehren wieder heim miteinander ins deutsche Vaterland. Bei uns ist's doch schöner und besser als im Heidenland; und dankbar wollen wir uns der Güter der Kultur und des Christentums in unserer Heimat freuen, – freuen aber auch darüber, daß auch von Deutschland Hilfe gespendet wird in die weite Welt hinaus und so das Gebot des großen Heidenmissionars Paulus sich erfüllt:
(Ende ≡)
Turm-Bücherei Band 25
Fürstl. Wald. Hoflieferant.
Anmerkungen
Anmerkungen der GenWiki-Redaktion (GWR) |